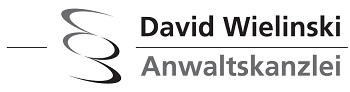Quelle: Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt vom 25.04.2025 – 7 UF 127/24
Leitsätze (zusammengefasst):
- Anrechte gleicher Art (§ 18 Abs. 1 VersAusglG) sind vor der Saldierung zu addieren.
- VBL- und KZVK-Anrechte sind gleichartig, auch bei unterschiedlicher steuerlicher Behandlung in der Leistungsphase.
- Für die Bagatellprüfung ist der korrespondierende Kapitalwert ohne Teilungskosten heranzuziehen.
Sachverhalt:
- Ehe von Juli 2012 bis Januar 2023.
- Beide Ehegatten erwarben während der Ehezeit Anrechte bei verschiedenen Versorgungsträgern:
- Antragstellerin: VBL (4.024,07 €), KZVK (4.742,51 €)
- Antragsgegner: VBL (10.023,07 €), RZVK (1.908,18 €), private Vorsorge (700 € + 1.671,50 €)
- AG Kassel hatte nur zwei Anrechte geteilt, andere wegen Geringfügigkeit (§ 18 Abs. 2 VersAusglG) unberücksichtigt gelassen.
- Die VBL, die KZVK und die Antragstellerin legten Beschwerde ein, v.a. wegen unterlassener Prüfung der Gleichartigkeit.
Kernpunkte der Entscheidung:
Weiterlesen