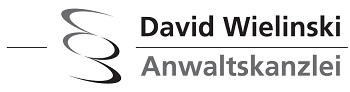Quelle: Urteil des Bundesgerichtshofs vom 02.07.2025 – IV ZR 93/24
Kernaussage:
Eine Zuwendung von Todes wegen zugunsten des behandelnden Arztes ist nicht allein deshalb unwirksam, weil sie gegen das berufsrechtliche Zuwendungsverbot nach § 32 Abs. 1 Satz 1 BO-Ä verstößt. Dieses Verbot wirkt nur berufsrechtlich und berührt nicht die zivilrechtliche Wirksamkeit testamentarischer Verfügungen.
Sachverhalt:
- Der Erblasser hatte 2016 einen Erbvertrag mit seinem Hausarzt und weiteren Personen abgeschlossen: Der Arzt sollte ärztliche und betreuende Leistungen erbringen und im Gegenzug nach dem Tod des Erblassers ein Grundstück als Vermächtnis erhalten.
- Nach dem Tod des Erblassers 2018 nahm eine weitere Erbin (die Beklagte) den Nachlass in Besitz.
- 2019 wurde über das Vermögen des Arztes das Insolvenzverfahren eröffnet.
- Der Insolvenzverwalter (Kläger) forderte das Grundstück vom Nachlass zur Insolvenzmasse zurück, gestützt auf eine Unwirksamkeit des Vermächtnisses wegen Verstoßes gegen § 32 BO-Ä.
Vorinstanzen:
- LG & OLG: Vermächtnis sei nach §§ 134, 2171 BGB nichtig, da gegen das standesrechtliche Zuwendungsverbot verstoßen worden sei.
- BGH: hebt das Urteil auf und verweist die Sache zurück.
Begründung des BGH:
Weiterlesen