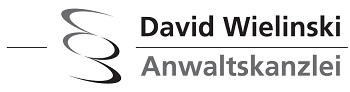Quelle: Pressemitteilung der Oberlandesgerichts Düsseldorf Nr. 46/2025 vom 01.12.2025
Die zum 1. Januar 2026 aktualisierte Düsseldorfer Tabelle ist ab sofort auf der Internetseite des Oberlandesgerichts Düsseldorf abrufbar. Gegenüber der Tabelle 2025 sind die Bedarfssätze minderjähriger und volljähriger Kinder angehoben worden. Außerdem sind die Anmerkungen zur Tabelle um Regelungen des angemessenen Selbstbehalts bei der Inanspruchnahme von Kindern auf Elternunterhalt und von Großeltern auf Enkelunterhalt ergänzt worden.
Die Düsseldorfer Tabelle ist ein allgemein anerkanntes Hilfsmittel für die Ermittlung des angemessenen Unterhalts im Sinne des § 1610 BGB. Die in der Tabelle ausgewiesenen Richtsätze sind Erfahrungswerte, die den Lebensbedarf des Kindes ausgerichtet an den Lebensverhältnissen der Eltern und an seinem Alter auf der Grundlage durchschnittlicher Lebenshaltungskosten typisieren, um so eine gleichmäßige Behandlung gleicher Lebenssachverhalte zu erreichen (BGH, Beschluss vom 20.09.2023 – XII ZB 177/22, Rn. 33).
Die Tabelle wird von allen Oberlandesgerichten zur Bestimmung des Kindesunterhalts verwandt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf gibt sie seit dem 1. Januar 1979 heraus. Sie wird unter Beteiligung und in Abstimmung sämtlicher Oberlandesgerichte und der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages e.V. erarbeitet.
Die Tabellenstruktur ist gegenüber 2025 unverändert. Es verbleibt bei 15 Einkommensgruppen und dem der Tabelle zugrundeliegenden Regelfall zweier Unterhaltsberechtigter. Die erste Einkommensgruppe endet weiterhin bei 2.100 EUR, die 15. Einkommensgruppe bei 11.200 EUR.