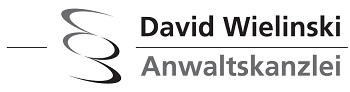Quelle:Urteil des Bundessozialgerichts vom 21.11.2024 – B 8 SO 5/23 R
Präzise und vollständige Zusammenfassung des Urteils des BSG vom 21.11.2024 – B 8 SO 5/23 R
Kernaussage des Urteils:
Das Bundessozialgericht (BSG) bestätigt, dass bei hinreichenden Anhaltspunkten für ein Überschreiten der 100.000-Euro-Jahreseinkommensgrenze gemäß § 94 Abs. 1a Satz 5 SGB XII i.V.m. § 117 SGB XII zunächst nur eine Auskunftspflicht hinsichtlich der Einkommensverhältnisse besteht. Ein weitergehendes Verlangen – etwa zu Vermögensverhältnissen – ist erst nach Feststellung eines Überschreitens dieser Grenze zulässig. Ein sofort umfassendes Auskunftsverlangen ist rechtswidrig und nicht teilbar, weshalb der Verwaltungsakt insgesamt aufgehoben wurde.
Sachverhalt:
- Der Beklagte (Sozialhilfeträger) zahlte ab 2018 Leistungen der Hilfe zur Pflege an den Vater des Klägers.
- Er forderte vom Kläger – Sohn des Leistungsempfängers – umfassend Auskunft über dessen Einkommen und Vermögen.
- Auf Widerspruch des Klägers hin ermittelte der Träger, dass der Kläger in Führungsposition bei einem wirtschaftlich erfolgreichen Beratungsunternehmen tätig war – dies wurde als hinreichender Anhaltspunkt für ein Einkommen über 100.000 € gewertet.
- Das SG Köln wies die Klage ab; das LSG NRW gab der Berufung statt und hob den Bescheid insgesamt auf.
- Der Beklagte legte Revision ein.
Rechtliche Würdigung durch das BSG:
1. Voraussetzungen der Auskunftspflicht:
- § 94 Abs. 1a SGB XII begrenzt den Übergang von Unterhaltsansprüchen auf den Sozialhilfeträger, wenn das Jahreseinkommen des Kindes oder Elternteils 100.000 € nicht überschreitet.
- Es besteht eine gesetzliche Vermutung des Nichtüberschreitens (Satz 3).
- Der Träger kann die Vermutung widerlegen, wenn „hinreichende Anhaltspunkte“ für ein Überschreiten bestehen (Satz 5).
- Bei Vorliegen solcher Anhaltspunkte ist § 117 SGB XII anwendbar, der Auskünfte erlaubt – aber nur, soweit sie für die Durchführung des SGB XII erforderlich sind.
2. Was sind hinreichende Anhaltspunkte?
- Keine „entfernte Möglichkeit“, sondern eine „gewisse Wahrscheinlichkeit“ eines Einkommens > 100.000 €.
- Anhaltspunkte dürfen durch öffentlich zugängliche Quellen (z. B. Internetrecherche) ermittelt werden.
- Im konkreten Fall: Leitungsposition, Größe und Umsatz des Unternehmens – zureichend.
3. Stufenverfahren:
- Das Gericht stellt klar: Es gilt ein zweistufiges Verfahren:
- 1. Stufe: Bei hinreichenden Anhaltspunkten darf nur Auskunft zum Einkommen im Sinne von § 16 SGB IV verlangt werden.
- 2. Stufe: Nur wenn Einkommen > 100.000 € festgestellt wird, darf der Träger auch das Vermögen erfragen.
4. Keine geltungserhaltende Reduktion:
- Auskunftsverlangen sind nicht teilbar.
- Ein rechtswidriges umfassendes Auskunftsverlangen (Einkommen und Vermögen) ist insgesamt aufzuheben.
- Der Beklagte hatte den Bescheid nicht aufteilbar gestaltet und die Reichweite nicht differenziert.
Zentrale Begründungen:
- Die Begrenzung auf das Einkommen schützt das Recht auf informationelle Selbstbestimmung von Angehörigen.
- Ziel des Gesetzgebers war die Entlastung von Familien und die Vermeidung abschreckender Wirkungen bei der Beantragung von Sozialhilfe.
- Der Verweis auf § 117 SGB XII ist eine Rechtsfolgenverweisung, nicht eine Ermächtigung zur umfassenden Ausforschung.
- Das Urteil folgt der bisherigen gesetzlichen Entwicklung von der Grundsicherung (GSiG, § 43 SGB XII a.F.) bis zum Angehörigen-Entlastungsgesetz (2020).
Bedeutung für die Praxis:
- Sozialhilfeträger müssen ihre Auskunftsersuchen differenziert und gestuft ausgestalten.
- Vor einer weitergehenden Vermögensabfrage ist ein konkreter Nachweis des Einkommens über 100.000 € erforderlich.
- Ein zu weit gehender Bescheid ist nicht heilbar und führt zur kompletten Aufhebung.
- Das Urteil stärkt den Schutz der Angehörigen vor übermäßiger behördlicher Ausforschung.
Fazit:
Das BSG stellt klar: Ein gestuftes Auskunftsverfahren ist zwingend. Bei hinreichenden Anhaltspunkten für ein hohes Einkommen darf nur dieses geprüft werden. Eine umfassende Abfrage von Anfang an ist rechtswidrig. Das Urteil betont den Schutz der familiären Privatsphäre und setzt ein deutliches Signal zur verhältnismäßigen Anwendung von Auskunftspflichten im Sozialhilferecht.