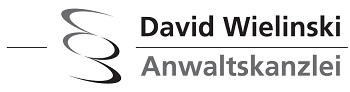Quelle: Beschluss des Budnesgerichtshofs vom 07.05.2025 – XII ZB 563/24
Sachverhalt:
Ein Sozialhilfeträger (Antragstellerin) fordert vom unterhaltspflichtigen Sohn (Antragsgegner) Elternunterhalt i.H.v. rund 6.200 €, nachdem er für dessen Mutter (geb. 1937) im Jahr 2020 Pflegeleistungen nach dem SGB XII erbracht hatte. Der Antragsgegner verdiente im Jahr 2020 rund 118.000 €, seine Ehefrau ähnlich viel. Eine volljährige Tochter lebte im gemeinsamen Haushalt. Zwei Geschwister des Antragsgegners wurden vom Träger nicht in Anspruch genommen.
Verfahrensgang:
- Amtsgericht: weist Antrag ab.
- Oberlandesgericht: gibt Antrag statt.
- BGH: bestätigt das OLG – die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos.
Kernaussagen und Argumentation des BGH:
- Keine Einschränkung zivilrechtlicher Unterhaltspflichten durch § 94 Abs. 1a SGB XII:
- Der Ausschluss des Anspruchsübergangs bei Einkommen ≤ 100.000 € (§ 94 Abs. 1a SGB XII) betrifft nur das Sozialhilferecht.
- Zivilrechtliche Unterhaltspflichten bestehen auch bei privilegierten Kindern (unter der Einkommensgrenze) weiterhin.
- Wichtiger Punkt: Die Einkommensgrenze begründet nicht automatisch eine unterhaltsrechtliche Unfähigkeit des Kindes.
- Folge bei Einkommen > 100.000 €:
- Überschreitet das Kind diese Grenze, gehen sämtliche Unterhaltsansprüche der Eltern auf den Sozialhilfeträger über – nicht nur der Teil oberhalb der Grenze.
- Zivilrecht ≠ Sozialhilferecht:
- Sozialhilferechtliche Rückgriffsbeschränkungen bestimmen nicht den Umfang der zivilrechtlichen Unterhaltspflicht.
- Der Gesetzgeber hat das bürgerliche Unterhaltsrecht bewusst nicht geändert – Elternunterhalt bleibt legitim und erforderlich.
- Keine Anpassung des Selbstbehalts an die 100.000-€-Grenze:
- Eine solche Anpassung würde zu Ungleichbehandlung und systemwidrigen Ergebnissen führen.
- Kinder mit Einkommen knapp über der Grenze würden übermäßig belastet, obwohl ihre privilegierten Geschwister weiterhin zur Mitverantwortung verpflichtet wären.
- Bei mehreren Geschwistern haftet jeder nur anteilig nach § 1606 Abs. 3 Satz 1 BGB.
- Keine Unterstützung durch bisherige BGH-Rechtsprechung:
- Die Rechtsprechung zum (vermuteten) Verbrauch des Familieneinkommens bei hohen Einkommen stützt nicht die Anhebung des Selbstbehalts auf Niveau der 100.000 €-Grenze.
- Ermittlung des angemessenen Selbstbehalts:
- Grundsatz: Ausgleich zwischen berechtigtem Elterninteresse und Lebensstandard des Kindes.
- Selbstbehalt ergibt sich aus:
- Abzug vorrangiger Unterhaltspflichten,
- anerkannten Belastungen (auch vermögensbildend),
- einem individuell bemessenen Betrag aus Mindestselbstbehalt plus Anteil des übersteigenden Einkommens.
- Auch nach Inkrafttreten des Angehörigen-Entlastungsgesetzes (2020) gelten:
- Durchschnittliche Einkommensverhältnisse als Bezugspunkt,
- keine pauschale Angleichung aller Kinder-Selbstbehalte, um Differenzierungen nach Einkommen und Belastung zu wahren.
Ergebnis:
Die 100.000 €-Grenze im SGB XII betrifft ausschließlich das Sozialhilferecht und nicht das zivilrechtliche Unterhaltsrecht. Die unterhaltspflichtigen Kinder bleiben – abhängig von Einzelfallumständen – verpflichtet. Der Selbstbehalt ist nicht starr, sondern nach konkreter Lebenssituation zu bemessen. Ein Rückgriff des Sozialhilfeträgers auf das Kind ist möglich, wenn dessen Einkommen über der Grenze liegt und die zivilrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.