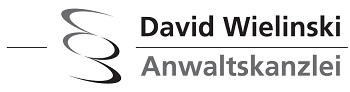Quelle: Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm vom 12.12.2024 – I-10- W 7/24
Sachverhalt:
Die Antragstellerin begehrte Prozesskostenhilfe (PKH), um ein testamentarisches Vermächtnis gegen ihre Schwester (Antragsgegnerin) gerichtlich geltend zu machen. Der Vater hatte sie nur unter der Bedingung bedacht, dass sie zum Zeitpunkt seines Todes im Güterstand der Gütertrennung lebte. Diese Bedingung erfüllte sie nicht. Das OLG hatte zu prüfen, ob die Bedingung sittenwidrig war und ob PKH zu gewähren sei.
Wesentliche rechtliche Kernaussagen:
- Prüfung bei PKH-Anträgen (§§ 114 ff. ZPO):
Auch bei rechtlich schwierigen Fragen ist im PKH-Verfahren die Erfolgsaussicht vollständig zu prüfen. Eine PKH kann auch bei nicht höchstrichterlich geklärten Rechtsfragen verweigert werden, wenn sie klar durch Gesetzesauslegung beantwortbar sind. - Testierfreiheit und Bedingungen (§§ 2074, 158 BGB):
Der Erblasser kann grundsätzlich Bedingungen für Vermächtnisse setzen. Die hier verwendete Bedingung (Nachweis der Gütertrennung) ist formell und materiell zulässig. - Keine Sittenwidrigkeit der Bedingung (§ 138 BGB):
- Testierfreiheit (Art. 14 GG) überwiegt gegenüber der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 GG) der Antragstellerin.
- Die Bedingung verfolgte das legitime Ziel, das Familienvermögen vor einem Zugriff von außen (insb. durch Schwiegerkinder) zu schützen.
- Die Ehefreiheit wurde nicht verletzt, da keine Eheschließung untersagt wurde und die Antragstellerin ihre Ehe unbeeinträchtigt hätte führen können.
- Die Erblasserverfügung übte keinen unzumutbaren Druck aus, da sie auf einem legitimen Motiv basierte (Erhalt des Familienvermögens).
- Bindungswirkung aus dem gemeinschaftlichen Testament von 1990 (§§ 2270, 2271 BGB):
- Das Testament verpflichtete lediglich zur Bedachung der Kinder irgendeiner Form (Erbe oder Vermächtnis), ließ aber die freie Auswahl und Gestaltung durch den Überlebenden offen.
- Es bestand keine wechselseitige Bindung hinsichtlich der konkreten Gestaltung der Zuwendung oder zur Gleichbehandlung aller Kinder.
- Folge einer evtl. Sittenwidrigkeit:
Selbst wenn die Bedingung sittenwidrig wäre, führte dies nicht automatisch zu einem unbedingten Vermächtnisanspruch. Da Bedingung und Zuwendung eine untrennbare Einheit bilden, ist keine Teilnichtigkeit im Sinne des § 139 BGB möglich.
– Eine ergänzende Auslegung zur Erhaltung des Vermächtnisses (ohne Bedingung) kam nicht in Betracht, da aus dem Testament kein hypothetischer Wille in diese Richtung ersichtlich war. Vielmehr war die Bedingung zentral für den Erblasser.
Ergebnis:
- Die beabsichtigte Klage der Antragstellerin hatte keine hinreichende Erfolgsaussicht.
- Die Bedingung im Testament war nicht sittenwidrig.
- Die PKH wurde daher zu Recht versagt.
Relevanz und Leitsätze:
- Kein Verstoß gegen die guten Sitten, wenn ein Vermächtnis an die Voraussetzung der Gütertrennung geknüpft wird – sofern dies aus nachvollziehbaren familiären Gründen erfolgt (z. B. Erhalt eines Familienunternehmens).
- Bindungswirkung eines gemeinschaftlichen Testaments ist auf den Wortlaut zu stützen – nur bei eindeutiger gegenseitiger Verfügungsbindung greift § 2270 BGB.
- Sittenwidrigkeit führt nicht automatisch zu einem unbedingten Vermächtnis, sondern kann die gesamte Zuwendung entfallen lassen.